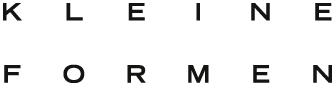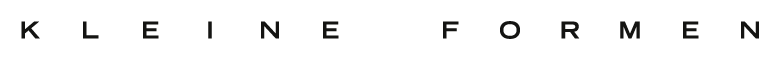Marie van Bömmel

Kurzvita
2023 Hospitanz Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom
2023 M.A. Global History, Freie Universität Berlin & Humboldt-Universität zu Berlin
2022–2023 Hilfskraft am Forschungsbereich Geschichte der Gefühle, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin
2020 B.A. Theaterwissenschaft / Geschichte, Freie Universität Berlin
2015/2016 Auslandsstudium, Bordeaux
2015 Schwerpunktprüfung Völkerrecht und Europarecht, Humboldt-Universität zu Berlin
Publikationen
[mit Johann Gartlinger, Marvin Renfordt und Ana María Orjuela-Acosta] Botanical Poetics. Interview with Jessica Rosenberg, in: microform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur- und Wissensgeschichte kleiner Formen, abrufbar unter: www.kleine-formen.de/botanical-poetics-Jessica-Rosenberg, Berlin 2025.
Ausstellen in Publikationen. Zum Wandel des Öffentlichwerdens von Kunst in den 1960er Jahren. Gastvortrag von Regine Ehleiter, in: microform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur- und Wissensgeschichte kleiner Formen, abrufbar unter: www.kleine-formen.de/gastvortrag-regine-ehleiter, Berlin 2024.
Vergessene Pionierinnen? Die Ausstellung Künstlerinnen international 1877–1977 als historiografische Intervention und Inspiration, in: GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 15 (2023), H. 3, 40–54.
Vorträge
All for one and one for all. The exhibition catalogue Künstlerinnen international 1877–1977, Tagung „Les artistes face au catalogue d’exposition“, Université Bordeaux Montaigne, Mai 2025.
Popularizing Feminism(s) – An exhibition catalog as a catalyst of a social movement, Tagung „Small Forms in Circulation: Infrastructures, Practices, Publics”, Humboldt-Universität zu Berlin, November 2024.
The exhibition catalog Künstlerinnen international 1877–1977 as dis:connective cultural infrastructure, Summer School „Cultural infrastructure(s)from ‘dis:connective perspectives’“, Käte Hamburger Research Centre global dis:connect, München, Juli 2024.
Women Artists Publishing Women Artists: The Catalog Künstlerinnen international 1877–1977 as an Artists’ Book, Symposium „Artists’ Publications – A Critical Approach to Historical and Contemporary Formats of Artistic Publishing“, Forschungsverbund Künstlerpublikationen in Kooperation mit der Universität Bremen, der Universität zu Köln und dem Zentrum für Künstlerpublikationen, Weserburg Museum für moderne Kunst Bremen, Juni 2024.
Künstlerinnen international 1877–1977. Die vielen Leben eines Ausstellungskatalogs
Im März 1977 eröffnet in Berlin eine Ausstellung, die ausschließlich Kunst von Frauen zeigt, zusammengetragen aus den großen Kunsthäusern Europas und Amerikas – und den Ateliers, Galerien und Schubladen ihrer Macherinnen. Manchen ist sie Offenbarung, anderen Ghettoisierung. Systemtreuen Opportunismus vermuten die einen, Hausfrauenkunst die anderen. Noch nie, so resümiert die Süddeutsche Zeitung, „hat eine Kunstausstellung in Berlin so viel Unfrieden gestiftet, so scharfe Kontroversen und Proteste provoziert“. Nur einer kann alle überzeugen: Der Ausstellungskatalog ist nach wenigen Tagen ausverkauft.
Er ist einzigartiger Ausweis eines aus der Frauenbewegung heraus unternommenen Versuchs, Kunstvermittlung feministischer Systemkritik anzudienen. „Für Frauen von Frauen über Frauen“, so die selbstgewählte Programmatik hinter diesem Ansinnen, ist Klammer einer groß angelegten Sammelbewegung: Wenig Geld und kaum Zeit erzwingen die kollaborative, grenzüberschreitende Beschaffung von Texten, Fotografien und Lebensdaten. Die Katalogmacherinnen wählen die wohl konservativste Form, dieses Material zu präsentieren: Über 200 Biografien füllen, in Vasari’scher Tradition, die zweite Kataloghälfte. Entgegen der ihr unterstellten Konsolidierungskraft entfaltet diese Kleinform im Berliner Ausstellungskatalog jedoch eine machtkritische Wendigkeit, die den prekären Bedingungen ihres Produktionskontexts opponieren kann. Aber wie nachhaltig ist dieses Subversionsvermögen? Obgleich der Katalog als ein „Gründungsdokument“ der feministischen Kunstgeschichte gelten kann, kennzeichnet ihn eine ambivalente Geschichte der (Nicht-)Beachtung. Ihr durch Wissenschaft, Ausstellungswesen, öffentliches und privates Erinnern folgend, soll die Untersuchung der „vielen Leben“ von Künstlerinnen international 1877–1977 die Künstlerinnenbiografie als Moderator zwischen Anpassung und Widerstand vorstellen und das Tradierungspotenzial eines feministischen Ausstellungskatalogs ermessen.
Künstlerinnen international 1877–1977. The many lives of an exhibition catalogue
In March 1977, an exhibition opens in Berlin featuring only works by women, brought together from major art institutions in Europe and America—and the studios, galleries, and drawers of their makers. It is a revelation to some, and ghettoization to others. Some dismiss it as opportunism, others as housewife art. Never, according to the Süddeutsche Zeitung, “has an art exhibition in Berlin caused so much discord, provoked such heated controversy and protests”. Only one thing convinces everyone: the exhibition catalogue sells out within a few days.
It is the unique document of an attempt to critique the art world from a feminist standpoint, engendered within the West German women’s movement. “For women, by women, about women” is the agenda behind this endeavour, which motivates a large-scale collection-project: limited financial resources and time require transnational cooperation in the gathering of texts, photographs, and biographical data. The catalogue editors chose one of the most conservative ways to present this material: in the tradition of Vasari, over 200 artist biographies fill the second half of the publication. Contrary to its supposed consolidating power, however, in the Berlin exhibition catalogue this small form reveals a critical agility that can counter the precarious conditions of its production context. But how lasting is this subversive potential? Although the catalogue can be considered a “founding document” of feminist art history in Germany, it is marked by an ambivalent history of (non)recognition. Following its trajectory through academia, exhibitions, and public and private memory, the investigation of the “many lives” of Künstlerinnen international 1877–1977 aims to both present the artist biography as a moderator between adaptation and resistance, and to assess the capacity of an exhibition catalogue to serve as a vehicle for feminist tradition building.